Lea Dohm ist Dipl.-Psychologin sowie tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin, Autorin, Journalistin sowie Mitgründerin der Initiative Psychologists for Future (Psy4F). Sie arbeitet als Transformationsberaterin bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) und beschäftigt sich in ihrer Arbeit vorrangig mit den psychologischen Dimensionen gesellschaftlicher Krisen, insbesondere der Klimakrise.
In diesem Interview spricht sie mit Scarlett Eckert, Geschäftsführerin der Intalcon Foundation, darüber, wie wir trotz belastender Gefühle handlungsfähig bleiben und sowohl persönlich als auch gesellschaftlich an den aktuellen Herausforderungen wachsen können. Ihre Einsichten bieten wertvolle Perspektiven, um die Gefühlskrise besser zu verstehen und folglich die Klimakrise besser bewältigen zu können.
Scarlett Eckert: Wie wirkt sich die Klimakrise auf unsere Gesundheit aus?
Lea Dohm: Die Weltgesundheitsorganisation WHO benennt Klimakrise und Artensterben als die größten Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit. Und tatsächlich ist es so, dass sich sämtliche ökologischen Krisen auf unterschiedlichen Wegen negativ auf unsere Gesundheit auswirken, z.B. Umweltgifte und Schadstoffe, die asthmatische oder Krebs-Erkrankungen (mit)auslösen oder die diversen tückischen gesundheitlichen Folgen von Hitze.
Im Bereich der psychischen Gesundheit kommen auch viele indirekte Effekte hinzu: Wenn z.B. Menschen zu klimawandelbedingter Flucht gezwungen sind, ist dies mit einer erheblichen psychischen Belastung und Traumatisierungsgefahr verbunden. Ein anderes Beispiel: Extremwetterereignisse, wie wir es hierzulande z.B. im Ahrtal erlebt haben, lassen selbst bei den Menschen, die nur indirekt betroffen waren und noch Monate später die psychischen Belastungen regional in die Höhe steigen. Die Folgen sind oft schwere und langwierige psychische Erkrankungen, die wir auf Dauer nicht mit der heutigen psychotherapeutischen Versorgung bewältigen können. Es ist heute schon oft sehr schwer, z.B. einen Therapieplatz zu finden.
Scarlett Eckert: Wie erklären Sie sich, dass sich mittlerweile dennoch eine ablehnende Haltung zu Nachhaltigkeit und speziell Naturschutz entwickelt hat?
Lea Dohm: Das hat nicht nur psychologische Gründe, sondern ist auch eine Folge eines anhaltenden politischen Agenda-Settings, das sich in Gefährdungsbeurteilungen nicht vorrangig an der Wissenschaft, sondern v.a. an emotional aufgeladenen Themen (Migration, Gendern…) bedient. Hinzu kommt aber auch eine wichtige Erkenntnis aus der psychologischen Forschung: Die Bereitschaft anderer zu Klima- und Umweltschutz wird systematisch unterschätzt. Das heißt, wir erleben es als Menschen schnell so, dass wir mit unserer Haltung allein dastehen - dies ist aber in der Regel nicht der Fall.
Hilfreich ist es, wenn wir uns trauen, mehr über Klima und Ökologie zu sprechen. Auf diese Weise gelangen all diese Inhalte wieder mehr in den Mainstream, wir fühlen uns weniger allein und gestalten ganz aktiv eine neue, nachhaltige Normalität mit.
Scarlett Eckert: Warum kommen wir trotz aller besorgniserregender Fakten und wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht ins Handeln?
Lea Dohm: Sehr viele Menschen haben durchaus bereits den Eindruck, etwas zu tun. Leider ist die Wirksamkeit des eigenen Handelns nicht immer sehr hoch, v.a. wenn wir uns auf individuelle Konsumveränderungen beschränken. Natürlich ist es aller Ehren wert, weniger Fleisch zu essen oder weniger zu fliegen – wir alle sollten uns hier umstellen. Die deutlich höhere Wirksamkeit entsteht allerdings, wenn wir gemeinsam mit anderen ins Handeln kommen und gemeinsam institutionelle und strukturelle Änderungen erwirken. Dazu bietet sich z.B. jegliche Art politischer Partizipation an, oder den eigenen Arbeitgeber und dessen Investment kritisch unter die Lupe zu nehmen und dort Veränderungen voranzubringen. Es ist hilfreich, konkrete, wirksame und machbare Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen – das verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns frustriert von allen Nachhaltigkeitsthemen abwenden oder sie sich zu sehr nach Verzicht anfühlen.
Scarlett Eckert: Was ist der „Global Bystander Effect“?
Lea Dohm: Der „Bystander Effect“ ist ein sehr gut untersuchtes psychologisches Phänomen. Er zeigt: Je mehr Menschen Zeuge einer Notlage werden, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne aktiv werden und eingreifen. Wer in einer belebten Innenstadt Opfer einer Straftat wird, hat somit im Durchschnitt mit weniger Unterstützung zu rechnen, als wenn dies in einer Seitenstraße mit nur einer überschaubaren Anzahl von Zeug*innen passiert. Bei Klimakrise und Artensterben begegnet uns dieser Effekt in einem globalen Ausmaß. Das führt dazu, dass wir dazu neigen, die Verantwortung immerzu hin- und herzuschieben: Auf China, die USA, die Politik, die Wirtschaft oder auch einfach auf meine Nachbarin, die jetzt schon wieder auf Kreuzfahrt gefahren ist und sich erstmal ändern müsste. Wir nutzen diese Strategie unbewusst als Ausrede, selbst nicht aktiv werden zu müssen. Dabei ist die Forschung sehr klar, wie ein gesellschaftlicher Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingen kann: Wir müssen alle ins Handeln kommen. Das ist sowieso vermutlich auch das sympathischere Vorgehen, als oft nur mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Scarlett Eckert: Wie können wir die Kommunikation über die Klimakrise erfolgreicher gestalten?
Lea Dohm: Indem wir es mit den Themen verknüpfen, die unser Gegenüber gerade besonders interessieren. Ein Landwirt wird ganz andere Inhalte als persönlich relevant erleben als eine Versicherungsmaklerin. Wir können uns somit immer wieder aufs Neue fragen: Was sind die Schnittstellen, die unsere Gesprächspartner*innen zum Thema Klima haben – und falls diese Person sie selbst noch nicht sieht, können wir sie recherchieren und aktiv aufzeigen.
Im Finanzsektor könnte es z.B. um die Abwägung von einer eher kurzfristigen Gewinnausrichtung, versus nachhaltiger Investments und langfristiger Perspektiven gehen. Dahinter stehen auch ethische Überlegungen, die oft mit Gewissensentscheidungen der Menschen verbunden sind. Ein spannendes Feld gerade auch für die Kommunikation miteinander! Aus psychologischer Sicht sind es übrigens gerade diese Haltungs- und Wertefragen, die uns als Menschen einander näherbringen und eine authentische, spürbare Verbindung zwischen uns entstehen lassen.
Scarlett Eckert: Sollte man den Begriff „Klimaschutz“ nicht eher vermeiden und stattdessen z.B. lieber „Menschenschutz“ oder „Gesundheitsschutz“ sagen?
Lea Dohm: Inhaltlich wäre das auf jeden Fall richtig und bestimmt gibt es auch Menschen, die sich von diesen Sprachbildern eher mitnehmen lassen. Aus meiner Sicht besteht hier aber eine klare Parallelität: Klimaschutz ist Menschenschutz und Gesundheitsschutz zugleich. Allein diesen Zusammenhang immer wieder aufzuzeigen kann sinnvoll sein, weil es Klima-Themen greifbarer werden lässt.
Scarlett Eckert: Was hat Sie dazu bewegt, das Buch „Klimagefühle“ zu schreiben?
Lea Dohm: Die Psychologie und Psychotherapie beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Frage, wie es Menschen gelingen kann, Klima- und Umweltthemen aktiv in ihr Denken, Fühlen und Handeln einzubinden. Dabei hat sich gezeigt, dass das deswegen herausfordernd sein kann, da die innere Auseinandersetzung auch unangenehme Gefühle wie Ärger, Angst, Schuld oder Traurigkeit in uns wecken kann. Das alles sind Gefühle, die wir als Menschen verständlicherweise lieber vermeiden – zugleich wissen wir aus den Naturwissenschaften, dass die konsequente Auseinandersetzung dringend geboten ist. Es ist daher sinnvoll, möglichst vielen Menschen zu helfen, die Auseinandersetzung einerseits nicht zu scheuen und sie andererseits möglichst auch konstruktiv mit eigenem wirksamen Handeln zu verbinden. Das Buch soll somit eine Hilfe sein, Verdrängung und Vermeidung zu überwinden und selbst eine Haltung zu Klima- und Umweltthemen zu entwickeln, die uns nicht überlastet.
Scarlett Eckert: Welche Klimagefühle beschreiben Sie in Ihrem Buch?
Lea Dohm: Meine Co-Autorin Mareike Schulze und ich stellen in dem Buch „Klimagefühle“ eine Verbindung zu der ganzen Palette der Emotionen her, die in der Auseinandersetzung mit Klimathemen auftauchen können. Das sind praktisch alle: Angefangen von einer milden Besorgnis über Traurigkeit, Ärger, Schuld und Scham bis hin zur Freude und Zuversicht – Gefühle, die insbesondere dann entstehen können, wenn wir uns mit dem Thema weniger alleine fühlen und machbare, wirksame Handlungsmöglichkeiten für uns gefunden haben.
Was ich gerne aus heutiger Sicht ergänzen würde: Auch sämtliche Handlungen oder klimapolitischen Maßnahmen können natürlich Gefühle aller Art in uns wecken. So kann es uns z.B. traurig machen, von einer gewohnten Art des Reisens Abschied zu nehmen oder ärgerlich machen, wenn wir bestimmte Veränderungen als wenig sinnvoll erachten. Unterm Strich erleben wir in diesen Jahren bestenfalls eine wohlüberlegte und sinnvolle sozial-ökologische Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Dass eine derart große gesellschaftliche Veränderung bei Menschen mit ganz unterschiedlichem emotionalen Erleben verbunden ist, ist logisch – und es gilt aus meiner Sicht genauer hinzusehen, damit wir uns als Gemeinschaft darüber nicht zu sehr auseinanderdividieren lassen.
„Wir müssen aufhören, Klima-, Umweltschutz und Wohlstand gegeneinander auszuspielen und als unvereinbar darzustellen.“
Scarlett Eckert: Welche Rolle spielen Klimagefühle beim nachhaltigen Investieren und in der Entscheidungsfindung innerhalb der Finanzbranche?
Lea Dohm: Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Finanzsektor noch nicht vollständig verstanden hat, wie bedeutsam und wirksam dieser selbst für das Gelingen einer fairen sozial-ökologischen Transformation sind und wie sehr die Zeit drängt. Insofern wäre es wünschenswert, wenn hier generell etwas mehr Klimagefühle statt Verdrängung auftauchen würden, da diese uns eher ins erforderliche Handeln führen können.
Aktuell liegt es noch zu sehr im persönlichen Ermessen von Einzelnen oder Unternehmen, inwieweit sie in ihren Finanzentscheidungen Nachhaltigkeit höher bewerten als z.B. die kurzfristige Rendite. Das kann z.B. mit Frust, Wut und Ärger verbunden sein, wenn wir feststellen, dass andere weniger Skrupel plagen und sie am Ende möglicherweise noch mit höherem finanziellen Gewinn belohnt werden. Menschen, denen es so geht, würde ich raten, sich mit anderen aus ihrem Feld zusammenzutun, und hier gemeinsam und mutig einen Wandel hin zu mehr Fairness und umweltethischen Standards zu gestalten.
Scarlett Eckert: Der Untertitel Ihres Buches lautet „Wie können wir an der Umweltkrise wachsen, anstatt zu verzweifeln“ – Können Sie ein paar Empfehlungen aus Ihrem Buch nennen.
Lea Dohm: Eine grundsätzliche Empfehlung und förderlich für die psychische Gesundheit ist es, sich etwas zu entschleunigen, die eigenen Gefühle überhaupt wahrzunehmen, sich dann mit den Themen näher zu beschäftigen und v.a. die Augen nach konstruktiven Handlungsmöglichkeiten offenzuhalten. Das gilt für die Finanzbranche genauso wie z.B. für den Gebäude- oder Verkehrssektor, die ebenfalls aktuell einen besonders hohen Transformationsdruck in Sachen Nachhaltigkeit haben.
Scarlett Eckert: Gibt es im Buch Praxisbeispiele, die auch im Kontext von banken- oder investmentbezogenen Entscheidungen relevant sein könnten?
Ja, denn das Buch bietet in vielfältiger Hinsicht die Möglichkeit, die eigene Haltung zum Thema zu erspüren und weiterzuentwickeln. Es ist eine Einladung zur Selbstreflexion. Somit wird hier eine psychologische Grundlage geschaffen auf deren Basis sich kollektiv gesündere Entscheidungen – natürlich auch in der wichtigen Finanzbranche - treffen lassen.
Scarlett Eckert: Wie kann der Wandel im Finanzsektor vorangetrieben werden und die Finanzbranche zu einer „neuen Normalität“ beitragen?
Lea Dohm: Indem wir damit aufhören, Klima-, Umweltschutz und Wohlstand gegeneinander auszuspielen und als unvereinbar darzustellen. Unser Wohlstand basiert auf stabilen Ökosystemen, denn deren Zusammenbruch würde logischerweise ebenso unser Wirtschaftssystem betreffen. Die Zeit drängt sehr, da wir bereits sieben von neun planetaren Grenzen überschritten haben. Ich würde mir daher wünschen, dass wir die Menschen, deren Investments und Wirtschaften aus der Zeit gefallen ist und unser aller Sicherheit und Gesundheit gefährdet, mutig mit diesen Tatsachen konfrontieren und zugleich konstruktive Alternativen für sie aufzeigen.
Scarlett Eckert: Vielen Dank für das Interview, Ihre Impluse und vor allem Ihr wertvoller Beitrag zur Lösungsfindung. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam mehr Menschen abholen und ins Handeln bringen können.
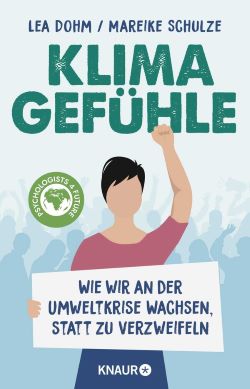
In ihrem Buch „Klimagefühle – Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln“ zeigen Lea Dohm und Mareike Schulze, wie uns Klimagefühle motivieren anstatt zu lähmen. Sie können es hier erwerben.
Weitere Informationen zu Lea Dohm und Ihrem Engagement finden sie auf Ihrer Webseite: www.leadohm.de













